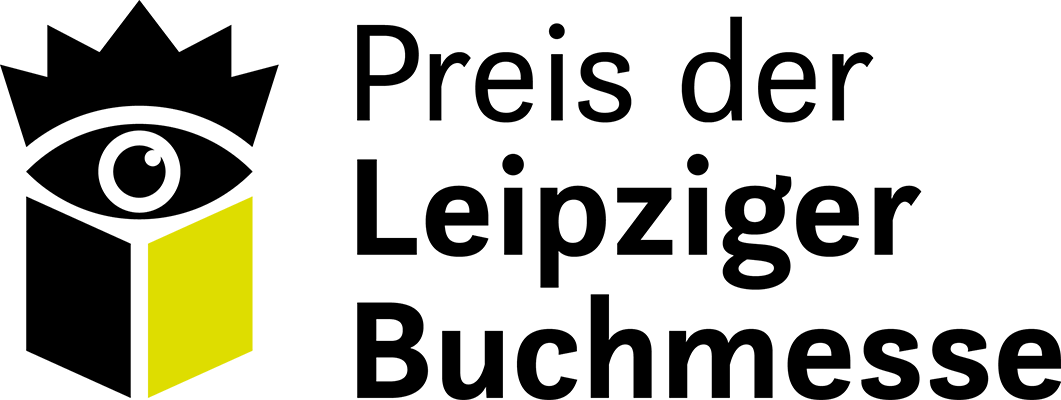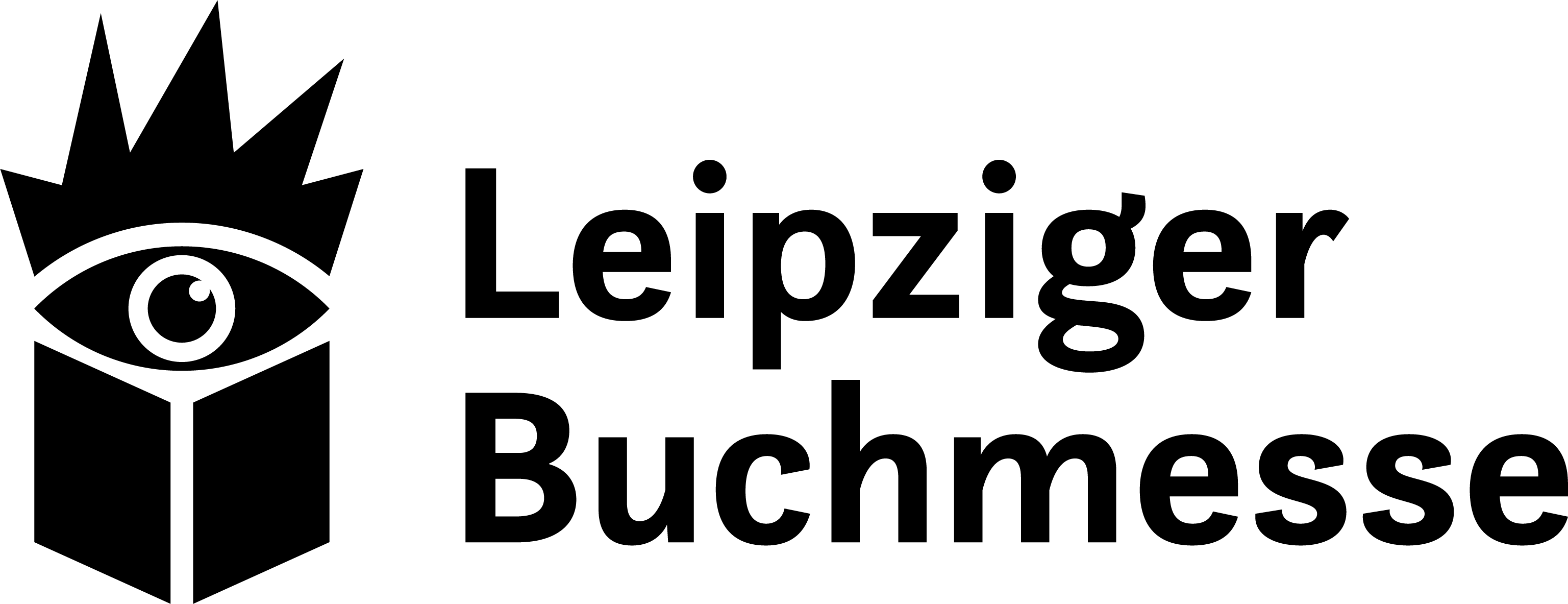BELLETRISTIK

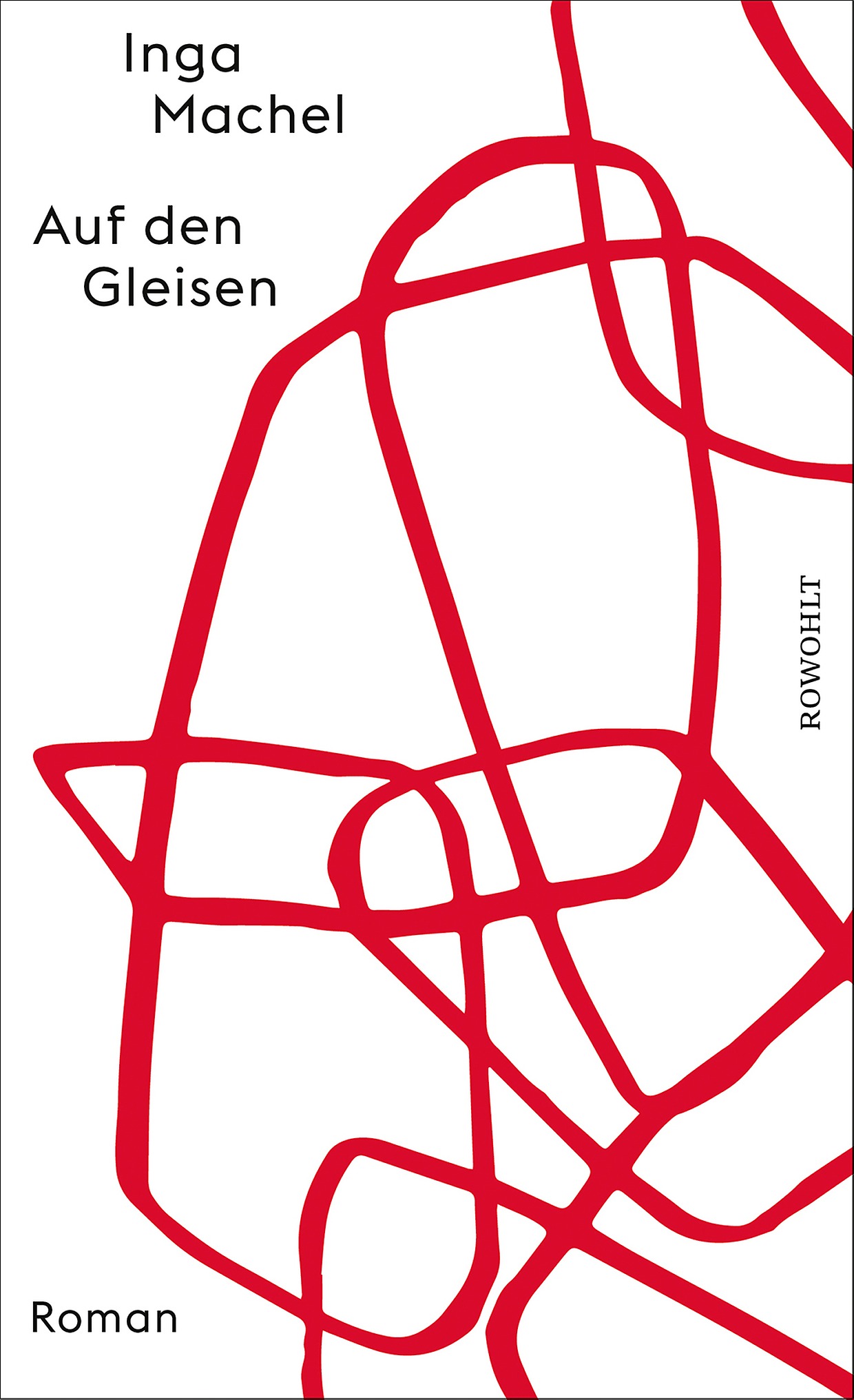
Inga Machel: Auf den Gleisen (Rowohlt Buchverlag)
Über das Buch
Als Mario Mitte zwanzig ist, nimmt sich sein Vater das Leben. Wenig mehr als ein einzelner Winterstiefel und ein Fotoalbum bleiben dem jungen Mann, der jetzt selbst ums Überleben kämpft. Er zieht aus der brandenburgischen Provinz nach Berlin, wo er, immer nah am Abgrund, sein neues Zuhause findet. Als er in einem heroinabhängigen Mann seinen Vater zu erkennen meint, heftet er sich an dessen Fersen und beginnt nach und nach seine eigene Vergangenheit zu verarbeiten. Inga Machels Debüt „Auf den Gleisen“ erzählt voller Feingefühl von dem tiefen Verlangen nach Nähe und Beziehung, vom Scheitern, von Schmerz, Wut und Trauer und von der Suche nach einem Weg ins Leben.
Zur Begründung der Jury
Inga Machels Roman »Auf den Gleisen« erzählt ungewöhnlich intensiv von Vater- und Selbstverlust, von Trauer und Rausch, von Auslöschungs- und Einschreibungsversuchen. Gefühlszustände zeigt Machel, ohne sie zu benennen, gesellschaftliche Rollen bringt sie in die Schwebe. Die raue Sprache kontrastiert mit fast pathetischen Tonregistern. Zugleich lässt sich dieser fragmentarisch und mehrspurig erzählte Roman als abstraktes Kunstwerk lesen, das Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit reflektiert.
Über die Autorin
Inga Machel, geboren 1986, studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Sie war freiberuflich als Rundfunkautorin und Lektorin tätig und ist außerdem Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihre Erzählung »Lieber A.« (2016) wurde mit dem New German Fiction Prize ausgezeichnet und erschien bei Matthes & Seitz als E-Book sowie als »Dear A.« in der Übersetzung von Donal McLaughlin bei Readux Books. Auf Tegel Media veröffentlichte sie die Story »Being with Paul« (2018). »Auf den Gleisen« ist ihr erster Roman.
Leseprobe
Auf den Gleisen
Was in der ersten Zeit nach dem Verschwinden meines Vaters passierte, kann ich, bis auf wenige Ausnahmen, nicht im Detail erinnern. Es waren meine Anfangsjahre in Berlin. Die besten Jahre, wie man sagt, ich war Mitte zwanzig. Ich weiß, dass ich oft einfach irgendwo gelegen habe, auf Gehwegen, Hausdächern, Kneipenklos, in Clubecken, Parks, neben Frauen und Männern, nach deren Namen ich nicht gefragt hatte. Abgestürzt und versunken in einen Zustand, der mir wie der Tod oder eine Vorstufe davon vorkam. In dem der Schmerz so absolut war, dass er nicht nur mich, sondern auch alles andere auszulöschen schien. Jegliche Existenz. Und ich fand, genau so war es richtig. Ich weiß, dass sich der Tod meines Vaters damals wie ein fremdes Organ in mir anfühlte, und ich spürte, es musste raus.